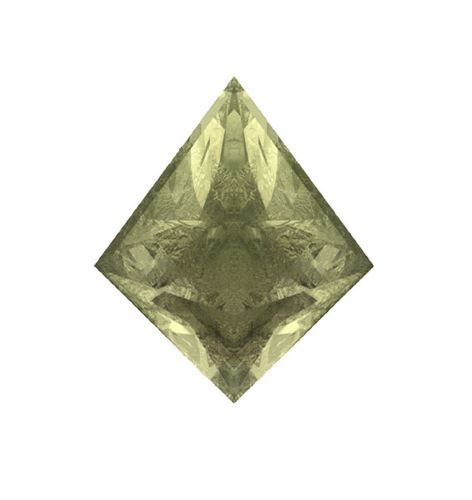Eine solche angestrebte Verstärkung einer menschlichen Fähigkeit (Intelligence Amplification) wie die der Kreativität durch eine Maschine kann zu zwei Einwänden führen: Eine Maschine, die die Kreativität eines Menschen verstärken soll, muß selber über umfangreiche menschliche Fähigkeiten verfügen (Emotionen etc.), um kreativ sein zu können. Dies ist aus verschiedenen Gründen unmöglich (Maschinen haben keinen Körper, kein Bewußtsein etc.). Eine Maschine, die die Kreativität eines Menschen verstärken soll, setzt die Simulation der Kreativität eines Menschen durch eine Maschine
voraus. Dies ist zur Zeit noch nicht möglich, wird aber als Fernziel wohl angestrebt.
Ich lehne die genannten Einwände ab, da beide auf der Annahme beruhen, daß die Verstärkung die Simulation erst voraussetzt. Dies ist aber nur teilweise richtig. Meiner Ansicht nach muß zwischen humanoiden und nicht‑
humanoiden Leistungen unterschieden werden. Die Verstärkung setzt die Simulaticn einer nicht-hunanoiden Intelligenz
oder einer nicht-humanoiden Kreativität voraus, aber nicht einer vollständig humanoiden Leistung (= nicht determinierbar, nicht berechenbar). Eine darüber hinausgehende Verstärkung setzt keine Simulation von humanoiden Leistungen als Bedingung voraus. Eine solche Verstärkung ist eine vom User erbrachte Leistung, die er teilweise der Maschine zuschreibt, da es zur Strategie der Maschine gehört, eine solche Täuschung innerhalb der Interaktion zu erzeugen. Somit weist der User der Maschine Eigenschaften zu, die diese objektiv nicht hat. Subjektiv erhält er den Eindruck, daß die Maschine humanoide Kreativität oder gar Intuition besitzt. Ab einem gewissen Punkt der Interaktion ist es für den User ineffektiv darüber nachzudenken, ob die Maschine wirklich im humanoiden Sinne kreativ ist oder nur so tut. Diese Inefffektivität herbeizuführen, kann schon Teil einer Strategie jener Art von Verstärkung sein, die die Simulation humanoider Leistungen nicht voraussetzt. Schließlich verstärken Mind machines und Bio-feedback Maschinen eine menschliche Fähigkeit, ohne daß sie selber als Maschinen Gefühle besitzen und verstehen müssten. Man stelle sich eine Person vor, die sich selber Tarotkarten legt. Die Karten bilden ein Zeichensystem mit bestimmten Regeln, die erweitert werden durch eine Zufallskomponente. Wenn man nun ausschließt, daß die Tarotkarten in einer paranormalen Beziehung zur Realität stehen, wie lässt sich dann die Situation zwischen Zeichensystem und Mensch beschreiben? Die Person, die die Karten legt und interpretiert tritt durch diese Karten in eine Beziehung zu sich selber. Sie tritt in Kontakt zu unbewußten Inhalten der eigenen Psyche. Somit sind die Karten Anlaß für Projektionen und psychische Automatismen. Sie haben eine ähnliche Funktion wie die Klecksbilder bei einem Rorschach Test.
Wenn man all die bisher dargelegten Punkte berücksichtigt, dann lässt sich die zentrale Fragestellung meiner Dissertation wie folgt formulieren:
- Ist es möglich, dass Maschinen und die durch sie produzierten Zeichen zum Bestandteil eines psychischen Prozesses werden? Ist es weiterhin möglich, diesen psychischen Prozess in Hinblick auf eine bestimmte Anwendung zu steuern ? Gibt es eine Verbindung zwischen vorhandenen Strategien der künstlichen Intelligenz (z.B. evolutionäre Optimierungsmethoden) und psychologischen Aspekten der Mensch-Maschine-Beziehung (Projektionen, Automatismen)? Muß dafür die Maschine vermenschlicht werden, indem sie sich selber als Mensch (3D-Animation) gegenüber dem User präsentiert? Ist es möglich, vorhandene Strategien der KI (Optimierungsmethoden) durch psychologische Strategien für bestimmte Anwendungen (Kreativität/Gestaltung) zu erweitern? Eine solche Erweiterung könnte z.B. ein interaktives Ergänzungsverfahren für eine Anwendung im Designbereich sein. Ein Gestalter möchte ein Muster (visuelles Zeichensystem) variieren. In einem Dialog an einem 3D-Grafiksystem entwickelt er mit der Maschine zusammen eine Fülle neuer Muster, indem er ein Teilmuster vorgibt und die Maschine es zu einem vollständigen Muster ergänzt. Oder die Maschine beginnt mit einem Teilmuster. Auf jeden Fall ist das fertige Muster Ergebnis eines gemeinsamen Gestaltungsprozesses.
Wenn eine Maschine nur darum denken kann, weil Menschen denken können, dann bedeutet dies, daß sie zum Bestandteil eines psychischen Prozesses werden muß. Die von der Maschine produzierten Zeichen werden zu Trägern psychischer Prozesse (Projektion), die Teil der psychischen Realität des Users sind und diese wechselseitig beeinflussen. Nur so kann der User in einer effizienten Beziehung zu sich selber treten. Das psychische Potential des Menschen und die Möglichkeiten es durch eine Maschine als Mittler zu aktivieren und nutzbar zu machen, ist bisher vernachlässigt worden. Die existierenden Expertensysteme zielen auf kognitive Leistungen ab. Ein Expertensystem für gestalterische Anwendungen (Design) ist mit den üblichenVoraussetzungen nicht realisierbar.