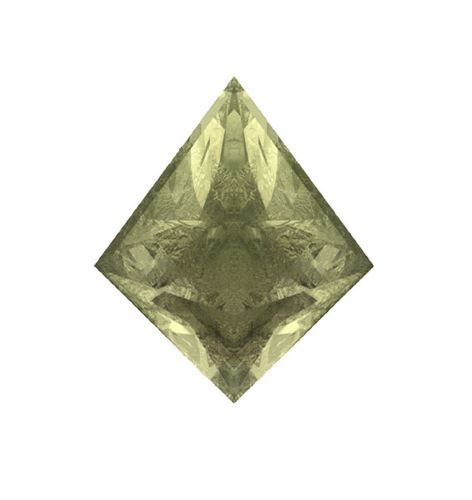Fritz Haug
Es gibt ein Thema, das sich wie ein Ariadnefaden durch die europäische Philosphiegeschichte zieht: die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt ,zwischen Sprache und Realität. Bei A R I S T O T E L E S wird dieses Problerem seiner ' Poetik ' als Mimesis analysiert. Ein Kunstwerk kann demnach entweder eine Abbildung (Imitation ) der Realität sein oder ihre Darstellung (als Idealsierung,z.B. im Pathos, Heroismus). Der Darstellung wird vor der bloßen Nachahmung der Vorzug gegeben, da sie den Menschen erziehen kann, indem sie Möglichkeiten der Verbesserung aufzeigt. Erklärt wird dieser Vorzug einer idealisierten Wiedergabe der Welt durch die graduelle Auffassung derselben wie sie in der Ideenlehre des P L A T O N zu finden ist. Danach ist die Welt geprägt durch eine Hierarchie an deren oberste Stelle die Ideen, das Allgemeine eines Begriffes, stehen. Das Besondere, das sinnlich Wahrnehmbare dagegen hat nur an den Ideen teil. Die Ideen sind das wahre Wesen der Dinge. Die Einzelerscheinungen, das Besondere der Dinge ist nicht die Wahrheit - sie haben nur graduell an ihr Teil. P L A T O N geht sogar so weit, daß er sie in seinem Höhlengleichnis als Hindernisse für die richtige Erkenntnis darstellt. ARISTOTELES mildert zwar diese Abwertung des Empirischen etwas ab, denn in seiner Lehre von Stoff und Form wird der Substanz als 'Wesen der Möglichkeit' eine zumindest nicht mehr erkenntnishemmende Rolle zugestanden. Aber er verwirft damit nicht die Auffassung der Welt als eine Hierarchie, in der die Einzelerscheinungen graduell an den Ideen teilhaben. Die man in seiner Logik in den Ausführungen zur Defintions‑
lehre erkennen kann, wo eine Definition durch die Unterscheidung in ' differentia specifica '(Das Besondere ) und 'genus
proximum' (das Allgemeine) gefunden wird. Die Wesensmetaphysik des A R I S T O T E L E S und die Ideenlehre des PLATON steIlen also keine Aufwertung der sinnlich wahrnehmbareh Einzelerscheinung gegenüber dem Wesen der Dinge dar. Das Mittelalter übernahm diese Vorstellungen über die Ordnung der Dinge nach dem Untergang der antiken Kulturen. Der einzige Unterschied lag darin, daß es selbst unter den Ideen eine Hierarchie gab, denn die oberste Idee war nun Gott. Er war nicht nur das Wesen aller Existenzen, sondern auch ihr erster Verursacher. Als Weltschöpfer hatte er alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge nach seinem Plan geschaffen. Die Vorstellung einer höchsten Idee ist auch die Vorstellung, daß der Plan der Existenz der Dinge vorausgeht.