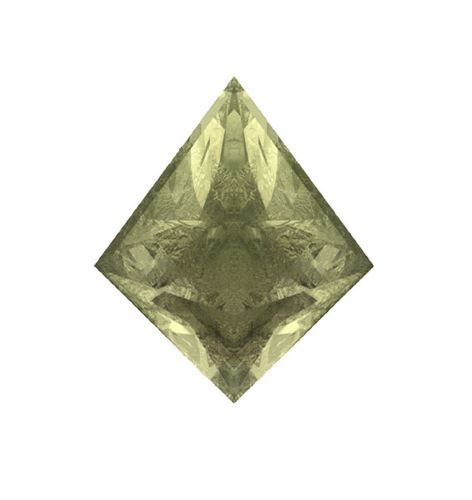Switches
Ethernet überträgt mit einer Geschwindigkeit von 10 Mbit/s. Noch vor einigen Jahren schien diese Geschwindigkeit auch für grössere Netze auszureichen. Durch den gestiegenen Bedarf an Kommunikation erreicht man die Leistungsgrenze von Ethernet inzwischen sehr schnell. Um Performanceprobleme zu vermelden, sollte man versuchen, Teilnetze mit hohem internen Verkehrsanteil, typischerweise Workgroups, durch Bridges vom Hauptnetz abzutrennen und somit das übrige Netz zu entlasten. Diese Strategie funktioniert jedoch nur dann, wenn zum einen die Bridge schnell genug für den Verkehr zwischen Workgroup und Backbone ist, zum anderen weder das Backbone-Ethemet noch das Workgroup-Ethernet zu langsam für den dort anfallenden Verkehr ist.
Reicht die Bandbreite für Ethernet nicht, braucht man ein schnelleres zentrales Medium als Backbone. Mehrere Strategien gibt es: entweder setzt man FDDI, ATM, Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet als Backbone-Technologie ein und verbindet die Ethernet-Segmente über Bridges mit dem schnellen Backbone, oder aber man verwendet einen Ethernet-Switch oder eine Multiport Bridge mit einem schnellen internen Bus als Backbone (coliapsed Backbone).
Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile: FDDI oder ATM erlauben es, den schnellen Backbone geographisch auszudehnen und damit auch grosse Netze zu konfigurieren. Auch lassen sich an diese Netze Rechner mit hohem Datenverkehr (z.B. Fileserver) direkt anschliessen. So kann man die Limitierung von 10 Mbit/s bei Ethernet für Einzelrechner auch noch umgehen. Collapsed-Backbone-Systeme kosten wesentlich weniger als FDDI- oder ATM-Lösungen. Sie begrenzen jedoch die geographische Ausdehnung, da die Ethernet-Segmente zu dem zentralen Switch geführt werden müssen.
Eine weitere Möglichkeit, höhere Performance in grossen Netzen zu erreichen, ist die Aufteilung in mehrere Subnetze und der Einsatz von Routern zwischen diesen Subnetzen. Im Gegensatz zu Lösungen mit Bridges dürfen dann mehrere aktive Pfade zwischen zwei Stationen bestehen. Allerdings ist der Managementaufwand solcher Netze erheblich höher. Auch verliert man dann an Flexibilität, weil eine Station nicht mehr einfach von einer Stelle im Netz zu einer anderen umgehängt werden kann, ohne dass z.B. IP-Adressen geändert werden müssen.
Was ist nun der Unterschied zwischen einem Switch und einer Multiport-Bridge? Technisch sind Switch und Bridge identisch, üblicherweise wird ein Layer-2-Gerät mit zwei Ports Bridge genannt und ein Layer-2-Gerät mit mehr als zwei Ports Switch.