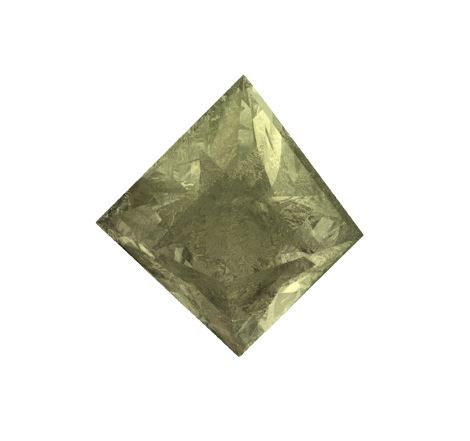
Gehirns (Assoziation und Dekodierung) sind aufs engste mit dem sprachlichen Charakter des Films verbunden.
Wenn man zu der photographischen Struktur ( Fotogenität) des Films, die Montage als die Organisation der Bilder in der Zeit hinzunimmt, dann besitzt man die beiden grundlegenden Unterschiede zu den anderen Künsten, besonders zum Theater. Im Theater werden Raum und Zeit nie so konstruiert wie im Film, in dem Realzeit und Filmzeit nicht identisch miteinander sind. Der Film lebt davon, die Illusion einer zeitlichen und räumlichen Kontinuität durch seine für ihn spezifische Konstruktion von Raum und Zeit zu erzeugen. So ist die Montage Bestandteil eines filmischen Stils.
EICHENBAUM sieht eine Gemeinsamkeit zwischen Filmsprache und verbaler Sprache in den Strukturen ihrer jeweiligen Organisation. Das einzelne Filmbild
( Photogramm ) ist gleich einem Atom, das erst auf der nächsthöheren Stufe, der Einstellung, aussagefähig wird. Mehrere nach bestimmten Kriterien miteinander verknüpfte Einstellungen ergeben einen Filmsatz, der seinerseits durch Verkettung zur übergeordneten Einheit der Filmsequenz führt. EICHENBAUM geht noch weiter in seiner Analogie von Filmsprache und verbaler Sprache. Er spricht von einer Filmsemantik, " d.h. von jenen Signalen, mittels derer der Film die Zuschauer den Sinn des Leinwandgeschehens verstehen lässt "
{ ALBERSMEIER,1979, S. 133 }. Das Wörterbuch einer solchen Filmsprache bilden die Gesten und die Gesichtsausdrücke der Schauspieler in ihrer jeweiligen isolierten Bedeutung. Von dieser lexikalischen Bedeutungsbestimmung unterschieden wird jener Sinn, der sich durch den Kontext, dem Vor und Danach, im Filmsatz ergibt. METZ würde hier von einer paradigmatischen und syntagmatischen Bedeutung sprechen. Weitere Zeichen des Wörterbuches einer Filmsprache wären Überblendung, Doppelbelichtung oder der Einsatz eines Weichzeichners.
Aus EICHENBAUMs "Probleme der Filmstilistik" zitiert nach ALBERSMEIER, 1979, S. 97ff:
Der Film wurde nicht von heute auf morgen zur Kunst. In seiner Geschichte muss man zwei Phasen unterscheiden: die Erfindung der Filmkamera, dank derer die Reproduktion von Bewegung auf der Leinwand möglich wurde, und die Nutzung dieser Filmkamera für die Verwandlung des fotografischen Filmstreifens in einen Film. Im ersten Stadium war der Film lediglich ein Apparat, ein Mechanismus; im zweiten Stadium wurde er zu einer Art Instrument




